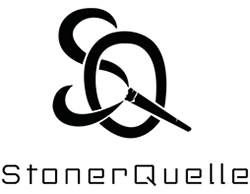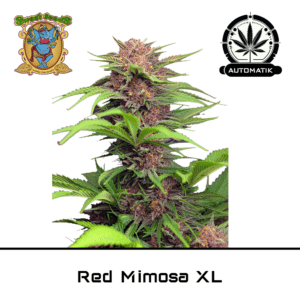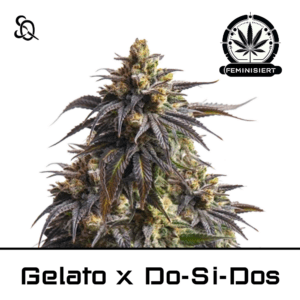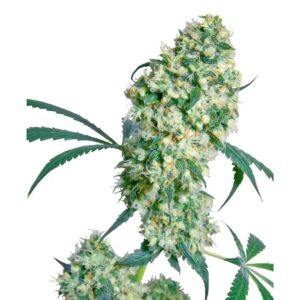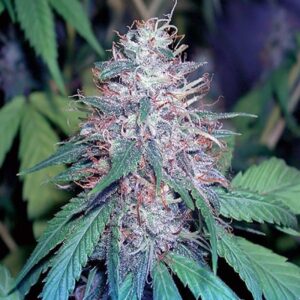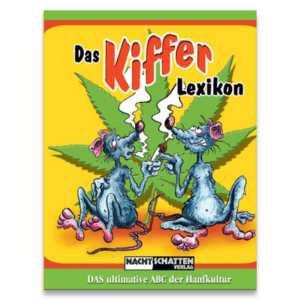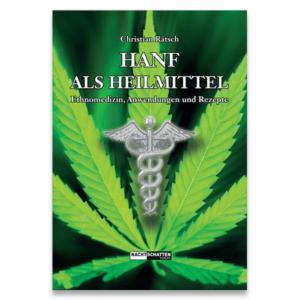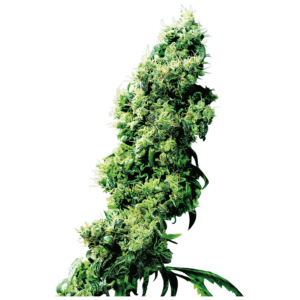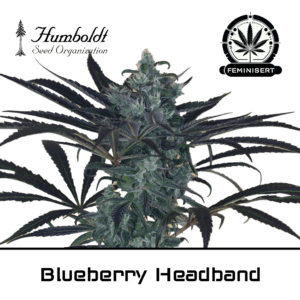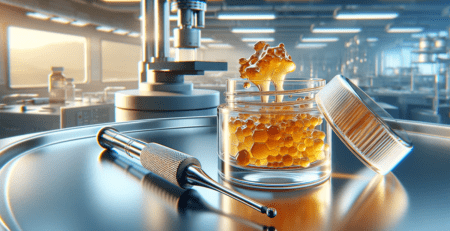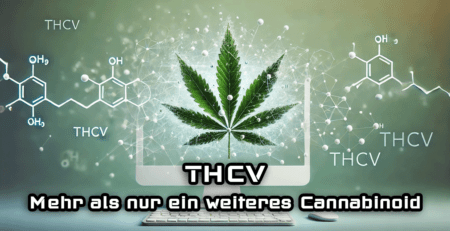KCanG bleibt bestehen: Koalitionsvertrag ohne Rückabwicklung
Cannabis Koalitionsvertrag 2025? Die Bekanntgabe durch CDU, CSU und SPD hat in der Cannabis-Community für Aufatmen gesorgt. Viele Beobachter hatten nach der Bundestagswahl mit einer politischen Kehrtwende gerechnet, insbesondere angesichts der wiederholt kritischen Töne aus den Reihen der Union gegenüber der Cannabisreform. Doch die Angst vor einem politischen Rückschritt war unbegründet. Der Koalitionsvertrag enthält keinerlei Pläne zur Rücknahme oder Einschränkung des Konsumcannabisgesetzes (KCanG).
Stattdessen wird im Vertrag eine ergebnisoffene Evaluierung des Gesetzes für Herbst 2025 angekündigt. Diese Formulierung ist entscheidend: Sie zeigt, dass die neue Bundesregierung zwar offen für Überprüfung und Nachbesserung ist, aber keine voreiligen Schlüsse ziehen oder ideologisch motivierte Maßnahmen ergreifen will. Das gibt dem Gesetz Zeit, seine Wirkung zu entfalten und auf realen Erfahrungen aufzubauen.
Damit sendet der Cannabis Koalitionsvertrag ein wichtiges Signal an die Öffentlichkeit: Deutschland hält am Prinzip einer wissenschaftlich begleiteten Legalisierung fest – und gibt dem KCanG Raum zur Weiterentwicklung.
Worum geht es beim Konsumcannabisgesetz (KCanG)?
Das Konsumcannabisgesetz, kurz KCanG, ist seit dem 1. April 2024 in Kraft und markiert einen historischen Wendepunkt in der deutschen Drogenpolitik. Es erlaubt volljährigen Personen unter anderem:
- den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis im öffentlichen Raum,
- den privaten Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen pro Person,
- sowie die Mitgliedschaft in nichtkommerziellen Anbauvereinigungen, in denen Cannabis gemeinschaftlich kultiviert und abgegeben wird.
Ziel des KCanG ist es, die gesellschaftlichen und gesundheitlichen Risiken des Cannabiskonsums nicht länger durch Verbotspolitik zu verschärfen, sondern durch Kontrolle, Aufklärung und Entkriminalisierung zu verringern. Der Schwarzmarkt soll geschwächt, Konsumierende geschützt und die Justiz entlastet werden.
Das Gesetz ist bewusst als ein Modell mit Evaluationsphase angelegt worden, um reale Auswirkungen zu prüfen und bei Bedarf justieren zu können. Deshalb ist die nun angekündigte Evaluierung nicht überraschend, sondern ein geplanter Bestandteil der Reform – und keine Gefährdung ihrer Substanz.
Der neue Koalitionsvertrag

Im aktuellen politischen Klima ist es alles andere als selbstverständlich, dass ein Reformgesetz wie das KCanG unberührt bleibt. Der Koalitionsvertrag 2025 bringt damit Stabilität in eine Debatte, die in den letzten Jahren stark polarisiert war. Es ist ein Etappensieg für die Legalisierungsbewegung, die sich jahrelang für eine sachliche und entkriminalisierende Cannabispolitik eingesetzt hat.
Die neue Regierung – bestehend aus CDU, CSU und SPD – hat sich darauf verständigt, das KCanG nicht rückgängig zu machen, sondern lediglich anhand seiner realen Wirkungen zu überprüfen. Die Formulierung „ergebnisoffene Evaluierung“ steht dabei für einen Ansatz, der nicht rückwärtsgewandt, sondern zukunftsorientiert ist.
Besonders bemerkenswert ist, dass diese Position im Konsens mit den Unionsparteien beschlossen wurde – also jenen politischen Kräften, die in der Vergangenheit immer wieder eine restriktivere Cannabispolitik gefordert hatten. Dies unterstreicht, dass sich der gesellschaftliche Wandel hin zur Akzeptanz von Cannabis nicht mehr leugnen lässt – auch nicht im parlamentarischen Raum.
Was bedeutet „ergebnisoffene Evaluierung“ für das KCanG?
Der Begriff „ergebnisoffen“ ist in der politischen Sprache von großer Bedeutung. Er signalisiert, dass keine Vorentscheidungen gefallen sind. Die Evaluierung des KCanG soll auf der Grundlage von Daten und Erfahrungen erfolgen, nicht auf ideologischer Basis. Ziel ist es, die Auswirkungen des Gesetzes auf zentrale gesellschaftliche Bereiche objektiv zu erfassen und auf dieser Basis sinnvolle Anpassungen vorzunehmen – wenn nötig.
Im Fokus stehen dabei unter anderem:
- Der Schwarzmarkt: Hat das legale Angebot den illegalen Handel bereits spürbar verdrängt?
- Jugendschutz: Funktionieren die Alterskontrollen in Anbauvereinen und beim privaten Eigenanbau?
- Gesundheitsschutz: Wird weniger gestrecktes Cannabis konsumiert, weil die Qualität transparenter ist?
- Belastung der Justiz: Wie stark sind Polizei und Gerichte durch die Entkriminalisierung entlastet worden?
- Gesellschaftliche Wahrnehmung: Gibt es Anzeichen für eine Normalisierung oder problematische Verharmlosung?
Diese Fragen sind entscheidend dafür, wie die Reform in Zukunft gestaltet wird – und ob sie sogar als Blaupause für einen regulierten Fachhandel dienen kann.
Warum das ein starkes Signal für Konsumierende und Clubs ist
Für Konsumierende und Anbauvereine bedeutet der Cannabis Koalitionsvertrag 2025 vor allem eines: Rechtssicherheit. Wer in legalen Strukturen aktiv ist, kann auch weiterhin planen, investieren und wachsen. Das Vertrauen in die politische Stabilität des Gesetzes wird gestärkt.
Auch für neue Initiativen und lokale Gemeinschaften bietet der Fortbestand des KCanG eine verlässliche Grundlage, um neue Projekte zu starten – etwa Anbauvereinigungen, Aufklärungskampagnen oder Forschungsvorhaben. In einem politischen Umfeld, das nicht von Verboten, sondern von Entwicklung geprägt ist, entsteht Raum für Innovation und Verantwortung.
Die Entscheidung, das KCanG nicht rückabzuwickeln, stärkt außerdem die Position Deutschlands im internationalen Vergleich: Als eines der ersten Länder Europas mit einem legalisierten Eigenanbaumodell für Erwachsene bleibt Deutschland ein Vorreiter der modernen Cannabispolitik.
Die Rolle der Community: Mitwirkung statt Abwarten
Auch wenn das Gesetz nicht abgeschafft wird, ist der Prozess keineswegs abgeschlossen. Die Evaluierung bietet sowohl Risiken als auch Chancen – je nachdem, wie transparent, laut und faktenbasiert die Community mitwirkt. Wer sich auf politischer, gesellschaftlicher oder medialer Ebene einbringt, kann Einfluss darauf nehmen, wie das Gesetz wahrgenommen und weiterentwickelt wird.
Dazu gehört:
- Das Sammeln und Teilen positiver Erfahrungen mit dem Eigenanbau,
- Die wissenschaftliche Begleitung von Anbauvereinen,
- Die Kommunikation der Vorteile der Entkriminalisierung – etwa durch gesunkene Strafverfahren oder Entlastung der Polizei,
- Und nicht zuletzt: öffentlicher Druck auf Politik und Medien, das Thema sachlich und differenziert zu behandeln.
Die Cannabis-Community darf jetzt nicht in Passivität verfallen. Die Chance, das KCanG dauerhaft zu sichern und perspektivisch weiter auszubauen – etwa in Richtung Fachgeschäfte – liegt auch in ihrer Hand.
Perspektiven auf EU-Ebene: Fachhandel bleibt Ziel

Während das KCanG in Deutschland vorerst Bestand hat, richtet sich der Blick vieler Fachleute und Aktivist:innen bereits auf die nächste Stufe: den staatlich regulierten Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Doch dieser Schritt ist auf EU-Ebene aktuell noch nicht möglich. Europäische Vorgaben, wie das Schengen-Durchführungsabkommen und EU-Rahmenbeschlüsse zum Drogenschutz, stehen dem im Weg.
Um einen legalen Fachhandel zu ermöglichen, braucht es langfristig eine liberalisierende Bewegung innerhalb der EU. Deutschland kann hier mit gutem Beispiel vorangehen – vorausgesetzt, das KCanG bewährt sich in der Praxis.
Das bedeutet: Die nächsten Jahre sind entscheidend. Je erfolgreicher die Umsetzung des KCanG verläuft, desto glaubwürdiger wird die Forderung nach einem legalen Handel mit Cannabisprodukten.
Fazit: KCanG bleibt – Cannabis Koalitionsvertrag als stabiler Rahmen für die Zukunft
Der neue Cannabis Koalitionsvertrag 2025 stellt klar: Das Konsumcannabisgesetz wird nicht rückgängig gemacht. Stattdessen soll es sachlich evaluiert und – falls nötig – angepasst werden. Das ist kein Rückschritt, sondern ein starkes Zeichen für die Etablierung einer verantwortungsvollen Cannabispolitik in Deutschland.
Für die Community, für Anbauvereine, für medizinische Patient:innen und für die Gesellschaft als Ganzes ist das ein Schritt nach vorne – hin zu einer klar geregelten, gesundheitsorientierten und sozialen Cannabispolitik. Die nächsten Monate bieten die Chance, das KCanG zu festigen, auszubauen und als Modell für Europa weiterzuentwickeln.